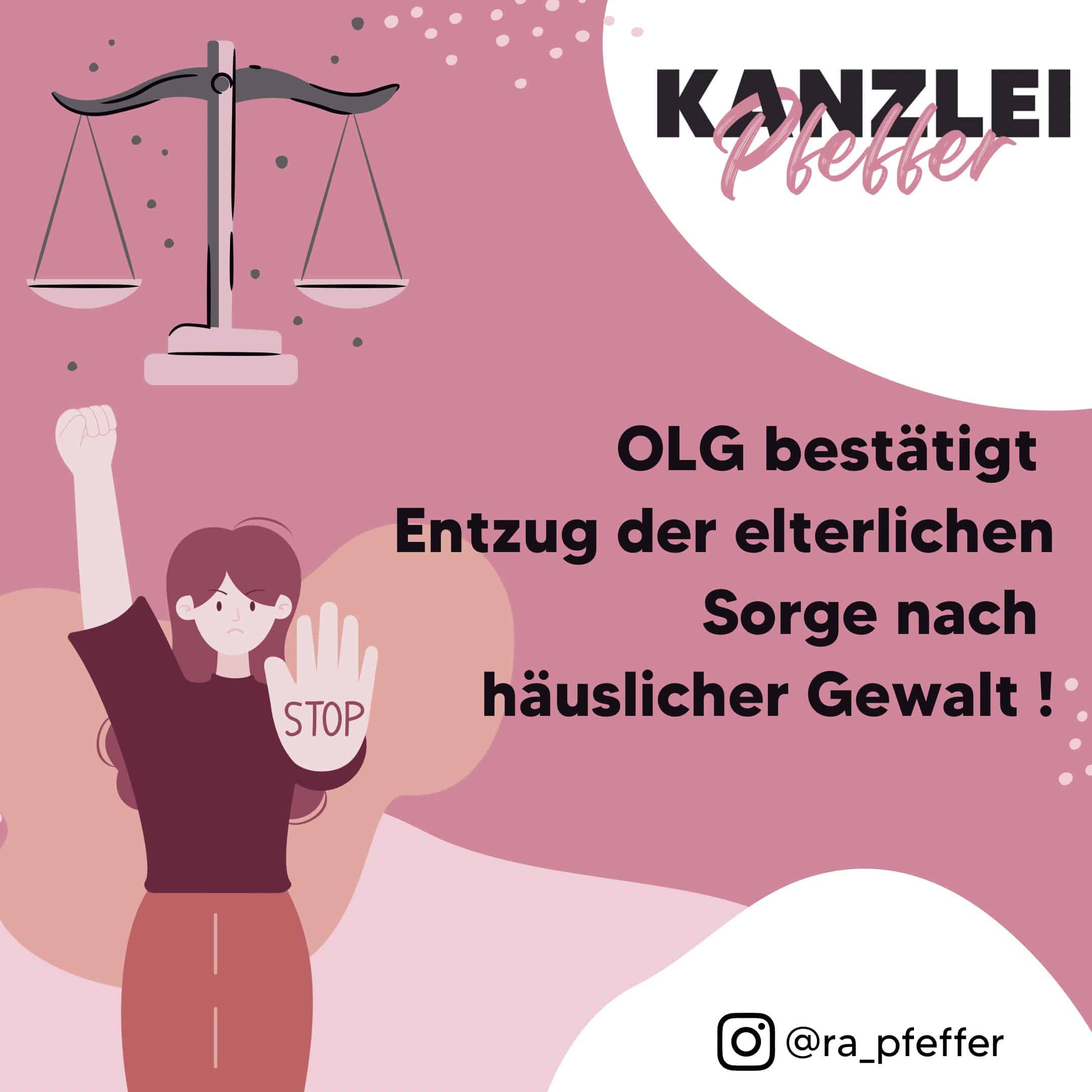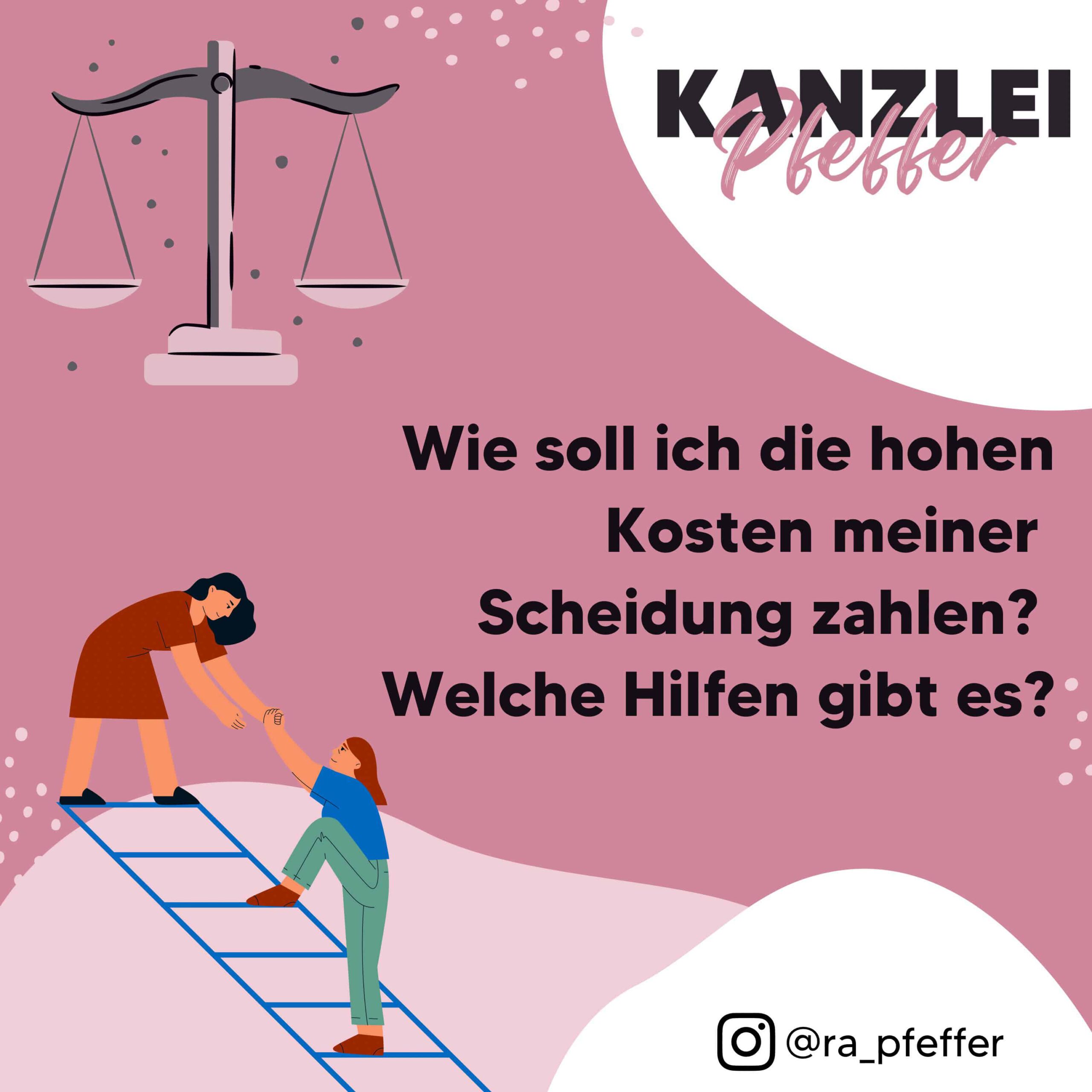{{placeholder content=’e3ticml6eV9kY19wb3N0X3RpdGxlfX0=‘}}
Vater verliert nach häuslicher Gewalt das Sorgerecht
In einem wegweisenden Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Az. 6 UF 144/24) wurde die Beschwerde eines Vaters abgewiesen, der die Zuerkennung des alleinigen Sorgerechts an die Mutter nicht akzeptieren wollte und Rechtsmittel einlegte. Der Fall basiert auf mehrfacher häuslicher Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter, die die gemeinsamen Kinder in diesem Fall miterlebt haben.
Das Gericht sah die Taten des Vaters als schwerwiegende Gefahr für das Kindeswohl an. Aufgrund der andauernden Gewalttaten und Todesdrohungen war eine gemeinsame elterliche Sorge nicht mehr möglich. Um die Kinder zu schützen, wurde das alleinige Sorgerecht der Mutter übertragen.
Ihre Rechte bei häuslicher Gewalt im Sorgerechtskonflikt
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Az. 6 UF 144/24) verdeutlicht, welche Auswirkungen häusliche Gewalt auf das Sorgerecht haben kann. In diesem Fall scheiterte der Versuch des Vaters, gegen das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt vorzugehen.
Es stand fest, dass der Vater mehrfach Gewalt gegen die Mutter angewendet und sie mit dem Tod bedroht hatte, was das Gericht als klare Grundlage zur Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts ansah. Entscheidend war, dass die Kinder Zeugen dieser Gewalt wurden. Das Gericht stellte fest, dass eine funktionierende Kommunikation zwischen den Eltern nicht möglich sei und das Wohl der Kinder durch die alleinige Sorge der Mutter besser gesichert werde.
Das Gericht hat somit die Festlegungen der sog. Istanbul-Konvention, deren Ziel der effektive Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt ist, praktisch umgesetzt.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Folgen
Nach § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB kann das alleinige Sorgerecht einem Elternteil zugesprochen werden, wenn dies zum Wohle des Kindes notwendig ist. Bei häuslicher Gewalt ist das Kindeswohl erheblich gefährdet, insbesondere wenn die Kinder die Vorfälle direkt miterleben, wie in diesem Fall. Das Gericht berücksichtigte auch den Wunsch der Kinder, bei der Mutter zu bleiben, obwohl sie noch jung sind.
Diese Entscheidung des OLG macht deutlich, dass häusliche Gewalt eine erhebliche Bedrohung für das Kindeswohl darstellt und die Übertragung der Alleinsorge auf den nicht gewalttätigen Elternteil rechtfertigt. Der Beschluss stärkt den Schutz der Opfer und betont die Bedeutung, häusliche Gewalt frühzeitig zu melden und Schutzmaßnahmen wie Kontakt- oder Näherungsverbote zu erwirken.
Sie sind Opfer von häuslicher Gewalt geworden?
Wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind, werden Sie sofort aktiv: Sie sollten unverzüglich handeln und folgende Schritte in die Wege leiten:
Gewalt melden und Schutzmaßnahmen erwirken
Anzeigen bei der Polizei und gerichtliche Schutzanordnungen wie Kontakt- und Näherungsverbote sind entscheidend, um sich und die Kinder zu schützen.
Beweise sammeln
Ärztliche Gutachten, Atteste, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Polizeiberichte, ggf. Fotos oder Videos der Verletzungen und des Verlaufs und eine gründliche Dokumentation der Vorfälle sind wichtige Beweise im Sorgerechtsverfahren.
Rechtliche Unterstützung einholen
Ihre spezialisierte Fachanwältin für Familienrecht hilft Ihnen, die bestmögliche Lösung für den Schutz Ihrer Kinder und Sie selbst zu finden. Sie arbeitet eng mit weiteren Stellen zusammen, die Ihnen zusätzliche – auch mentale Unterstützung bieten können.
Häusliche Gewalt ist leider immer noch ein Tabuthema, kann aber in allen gesellschaftlichen Kreisen auftreten und ist unabhängig von Bildungs- oder Einkommenssituation. Zum Wohle Ihrer Kinder ist es deshalb wichtig, sofort zu agieren. Als Fachanwältin für Familienrecht unterstütze ich Sie einfühlsam und verständnisvoll in dieser für Sie schwierigen Situation und erarbeite mit Ihnen das beste Vorgehen.
Vereinbaren Sie telefonisch oder bequem online einen persönlichen Beratungstermin bei Rechtsanwältin Pfeffer.
{{ brizy_dc_global_blocks position=’bottom‘ }}